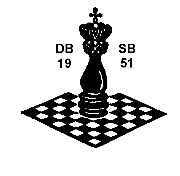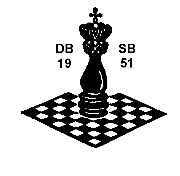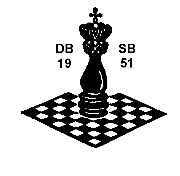
Deutsche Blindenschach- und Sehbehindertenschach- Einzelmeisterschaften in
Knüllwald vom 27.5. bis 5.6.
(von Klaus-Jörg Lais, Saarbrücken)
Hallo erst mal...
Man stolpert ziemlich unbeholfen da rein. "Guten Abend meine Herrschaften,
Klaus-Jörg Lais hier vom Deutschen Schachbund" höre ich mich wie von Ferne
selber sagen und komme mir dabei ziemlich blöd vor. Wieso sage ich
Herrschaften? Meine Damen und Herren wäre besser gewesen, es sind nämlich
viele Damen am Tisch. "Hier ist der Hanswurst von der Deutschen Post" hätte
nicht blöder klingen können, wenn man so vor der Runde steht. Und plötzlich
verstummt jedes Gespräch, denn man hat mich ja nicht kommen sehen. Ich bin
zu Gast bei der Deutschen Einzel-Meisterschaft des Blinden- und
Sehbehinderten- Schachbund in ganz eigenem Interesse, denn ich hatte mich
darauf mit viel Neugier schon lange vorher gefreut. Wie spielen Blinde
untereinander Schach? Welche Möglichkeiten, welche Stärken und Schwächen
gibt es? Wie ist der Umgang miteinander?
"Ich mache für den DSB die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit" schiebe ich
nach und fühle mich gleich noch mal viel hilfloser und das klingt ja wohl
völlig bescheuert, denke ich. Wie jetzt all die Leute hier begrüßen?
Rundherum laufen und die Hand zum Gruß ausstrecken wird nicht reichen und
wohl auch irre lang dauern. Kann man sich etwas unter meinem Namen
vorstellen? Ist man vorbereitet? Wer sieht mich denn überhaupt? Wer sieht
mich nur als Schatten oder Umriss? Also klopfe ich laut auf den Tisch zur
Begrüßung und sage "Zur Begrüßung klopfe ich mal laut auf den Tisch". Geht
schon viel besser und alle lachen zurück.
Ludwig Beutelhoff empfängt mich herzlich und wir kommen gleich ins Gespräch.
Morgen soll sie starten, die deutsche Einzelmeisterschaft. Hier sitzt gut
und gerne die Hälfte der Teilnehmer gesellig beieinander. Das ist ungewohnt
in den Turnieren, bei denen ich sonst bin.
Den DBSB drücken große Nachwuchssorgen. Es gibt kaum noch spezielle
Blindenschulen, unter deren Schüler sich viele potenzielle Mitglieder finden
ließen. Aber selbst in der bekanntesten Blindenschule Marburg, gibt es zur
Zeit leider keine Schachgruppe.
Ich habe tausend Fragen, aber versuche, das erst mal zu verbergen. Welche
Voraussetzungen sind wichtig - wer spielt? "Die Sehbehinderung darf nicht
weniger als 10% betragen, das ist der internationale Standard. Früher waren
es 5%," erfahre ich. Blinde und Sehbehinderte spielen auch andere
Bedenkzeiten als bei der Deutschen Meisterschaft, allerdings nichts unter 30
Minuten. Ich erfahre auch etwas über Stichkämpfe: Im Pokalwettbewerb zum
Beispiel, entscheidet bei Beteiligung des DBSB bei Remis oder Unentschieden
nach Berliner Wertung immer das Los. Schnellschach oder Blitz gibt es dann
nicht.
In diesem Jahr wird die Einzelmeisterschaft übrigens erstmals in einem
offenen Modus ausgetragen bei Schweizer System. Sonst gab es früher immer
die Vorqualifikationen und man spielte schließlich in elf Runden bei zwölf
Teilnehmern vollrundig.
Mal sehen
Anderntags begrüßt der sehende Turnierleiter Herbert Lang die Teilnehmer.
"Zu mir, zu mir", ruft Anton Lindenmair zu Beginn des ersten Spieltags durch
den Raum, als ihm gewahr wird, das sein heutiger Gegner Fred Schulz gerade
den Raum betritt. Zu den vielen merkwürdig umständlichen Dingen, die man
hier beobachtet, gehört das ständige gegenseitige Beschreiben der örtlichen
Lage. Manfred Müller als Organisator der diesjährigen Meisterschaft,
beschreibt den Turniersaal und die Umgebung ("So, liebe Freunde. Zur
Situation hier...") zuallererst: Wo sind die Toiletten? Wie groß ist der
Raum? Wie sind die Tische angeordnet? Wo ist die Tür nach draußen? Wo dürfen
die Raucher hin?
Wahrscheinlich kennt jeder von uns einen Blinden. Wir haben uns auch schon
Gedanken gemacht, wie das wohl sein könnte. Aber verbringen Sie nur mal eine
Stunde mit einer Gruppe blinder Menschen: Die besonderen Umstände brechen
auf Sie herein, als ob Sie gerade erfahren, dass die Schwerkraft im Weltall
außer Kraft gesetzt ist. Nichts. Nichts ist selbstverständlich.
Mit Blinden auch nur drei Tage zusammen zu sein, erfordert einiges an
Aufmerksamkeit. Sie mögen sich für ein Gewohnheitstier halten, aber Blinde
sind mehr als das. Sie sind echte Dinosaurier der Gewohnheit. Wenn Ihre
ganze Welt dadurch bestimmt wird, dass Sie unfähig sind, die
augenscheinlichsten Sachen wahrzunehmen, dann möchten Sie ganz genau wissen,
wo sich ihre Sachen befinden. Sie möchten auf dem gleichen Stuhl sitzen, den
gleichen Nachbarn haben, denselben Aufzug nehmen und ihr Glas genau dort
vorfinden, wo Sie es zuletzt abgestellt haben. Eines der schlimmsten Dinge,
die man einem blinden Menschen antun kann, ist ihre unmittelbare Umgebung zu
verändern. Ich meine das nicht im bösartigen Sinne, das würde niemand tun.
Aber stellen wir uns vor, Sie wollten bloß ein bisschen behilflich sein und
die in Ihrem Auge auffallende Unordnung beseitigen: Sie heben den
Blinden-Stock auf, der anscheinend unter den Tisch gefallen ist. Sie gießen
hilfsbereit das Getränk im Glas nach und stellen es nahe heran, damit der
gute Mensch es direkt vor sich hat. Sie schließen die Tür, weil es zieht und
rücken den Stuhl neben ihm an den Tisch, damit sich der gute Mensch dort
abstützen kann beim Aufstehen. Was passiert aber nun tatsächlich?
Der Blinde wird zunächst beim Aufstehen nach dem Stuhl nebenan mit Verve ins
Leere greifen. Wenn er dann nicht gefallen ist, wird er sich womöglich am
Tisch festhalten, wo das von Ihnen frisch gefüllte Glas steht. Sollte er
auch diese Hürde genommen haben, ohne alles zu verschütten, wird er sich
erfolglos nach unten bücken, um den Stock zu suchen, den er genau dort ja
abgelegt hat. Aber vielleicht sind Sie noch schnell genug bei ihm, bevor er
das Gleichgewicht verliert und haben auch das wieder repariert. Nun
vergessen Sie bitte nicht, auch die Tür noch mal zu öffnen, denn sonst läuft
der gute Mensch da einfach dagegen. Es gibt für Blinde einfach eine völlig
andere Definition der Ordnung. Und die sieht nun mal so aus, dass man weiß,
was man wo vorfindet. Aber wie das wiederum für uns aussieht, spielt in
dieser Ordnung keine Rolle.
Achtung, Tiefflug!
"Springer Anton 2" ruft Gert Schulz durch den Raum. Reinhard Niehaus, der an
der anderen Seite des Spielraums sitzt, scheint zu entgegnen: "Kurze Rochade".
"Kurze Rochade" wiederholt Jürgen Pohlers, bevor Johann Pollinger "Springer
Emil Vier" ausruft. Also daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Gerade in
der Anfangsphase wird der Raum durchflutet von Zugansagen und wie ein Echo
wiederholt der Gegenübersitzende den Zug, damit keine Missverständnisse
entstehen. Das muss per Regel auch so sein. Ich stelle mir vor, wie das auf
einen Nichtschachspieler wirkt. Und dann fliegen diese Satzfetzen wie UFOs
durch den Raum. Oder wie codierte Formeln einst durch die Leitungen der
Geheimdienste. Springer Dora Sieben. Achtung. Pollenflug! Läufer schlägt
Cäsar Drei! Vorsicht. Infektionsgefahr. Dame schlägt Berta Vier. Arme Berta.
Die Finger des vollständig blinden Dieter Bischoff tasten sich auf dem
Blindenschachbrett vor. "Läufer schlägt Friedrich Fünf" sagt er. Das hat er
gut gesehen, denke ich.
Kann man das konzentrationstechnisch überhaupt durchstehen? Bei uns im
sehenden Schach ist es doch totenstill. Da ist jedes Stuhlknarzen, jede
ruckartige Bewegung störend. Die Zugansagen seien aber absolut
unproblematisch, so werde ich aufgeklärt. Bloß jedes andere, vorher nicht
erwartete Geräusch oder Unterhaltungen sind störend. Zugansagen werden
ausgefiltert, sozusagen. Ich würde hier jedenfalls keinen klaren Gedanken
fassen. Immer wieder ruft jemand, immer wieder rattert die Blista, wie ich
sie nenne. Denn das steht da auf jedem Gerät drauf. Blista. Das ist dieses
seltsame Sieben-Tasten-Gerät, mit dem notiert wird.
Reine Nervensache
Dame Emil Sechs, das klingt klackadiklickadiklack. Ich will es nicht
überstrapazieren, aber mir scheint, die haben hier Nerven wie Stahlseile.
Später erfahre ich, dass Blista für Blindenstudienanstalt steht und diese
technisch erbärmlich einfachen Geräte mehrere hundert Euro kosten.
Eigentlich heißt das Ding ja "Mini-Picht". Picht, wegen eines
österreichischen Blindenlehrers aus dem 19. Jahrhundert, der diese Art
Schreibmaschine für die 6-Punkt-Blindenschrift erfunden hat.
Die Schachuhren zu drücken ist auch für Blinde leicht, aber was gibt die Uhr
eigentlich aus? Nach einer guten Weile fällt auf, dass die Uhren nicht nur
obenauf in Braille beschriftet sind, sondern auch gar keine Gläser wie die
normalen Uhren haben. Hinzu kommt für jede Stunde eine Brailleziffer und so
kann man anhand des Tastvermögens die verbrauchte Bedenkzeit erfahren.
"Probieren Sie's mal" fordert mich Herbert Lang auf. Ich schließe die Augen.
Meine Wurstfinger verschieben schon beim ersten Versuch den Minutenzeiger.
Das Fallblättchen. Groß, Rot, metallisch, in V-Form. Der Turnierleiter klärt
mich auf: Links wird gefühlt, wie weit sich das Blättchen vom Fallen
entfernt befindet. Aha. Ich teste noch mal. Für mich ist es schon eine
anständige Erfahrung, die V-Form zu tasten.
Herbert Lang kam "wie die Jungfrau zum Kinde", wie er selber sagt, zum
Blindenschachbund. Der damalige Vorsitzende des DBSB fragte im Kreis
Heidelberg nach einem Helfer für die Turniere. Darauf hat er sich gemeldet
und seit 1976 begleitet Lang nun schon den DBSB. Lang gehört sozusagen zum
Inventar. "Schreiben Sie: Mädchen für alles", lacht er scherzhaft. Und das
stimmt wohl auch. Er sitzt von Anfang bis Ende der Spielzeit mit dabei,
kümmert sich um Ergebnisse und Auslosung, gibt Hilfestellungen im
organisatorischen Bereich, zeigt wo die Spiele sitzen sollen, beschreibt die
Umgebung, notiert in Zeitnot mit, hilft, wo er kann.
Ganz nah dran
Volkmar Lücke gehört zur Sehbehindertengruppe. Das bedeutet, er hat noch ein
eher rudimentäres Restsehvermögen. "Wenn es doch hier wenigstens heller
wäre!" schimpfte er beim Frühstück morgens, als er unter den Wurstscheiben
nach der Butter forschte. Sollte das ein Witz sein? So ein Blindenwitz, den
man sich nur erlauben kann, wenn man selbst blind ist? Aber ich bin es, der
sich hilflos vorkommt, als ich ihm beim Butterforschungsversuch zusehe und
das Messer links, vor, rechts, dirigiere. Er macht sich da jedenfalls nichts
draus.
Später im Spielsaal ist es hell. Dafür hat er selbst gesorgt. Denn zu seiner
Ausrüstung gehört neben dem Blindenschachbrett und dem riesigen
Notationsformular, auf dem gerade mal 30 Züge stehen, eine
Lampenkonstruktion, die gleißend helles Licht aufs Brett wirft. So kann er
etwas sehen und seine konzentrierte Denkhaltung am Brett sieht jetzt kein
bisschen anders aus, als die von all den vielen Schachspielerbildern, die
wir kennen.
Die Blistas, pardon Mini-Pichts, gibt es in einer Menge Ausführungen.
Johann Pollinger hat deutlich das älteste Modell. In dieser Version sieht
das Teil ein bisschen so aus, wie eine antike Miniaturschreibmaschine.
Andere Modelle haben Streifen-Notationen. Mit jedem Klickadiklackadiklick
kommt ein bisschen mehr Streifen mit Punkten drauf da raus. Ich betrachte
die Punkte - und erkenne gar nichts. Was für eine Ignoranz gegenüber
Sehbehinderten. Das ist deren einzige Schrift und Du erkennst nicht mal ein
A, denke ich.
Aber Reinhard Niehaus, der - ebenfalls restsehend - eigentlich am
Nachbartisch spielt. Er fasst im Vorbeigehen den Streifen an, prüft, was
zuletzt gezogen wurde. Dann beugt er sich ganz nah zum Brett, um zu
kiebitzen. Er ist so nah über den Figuren, dass ich Angst habe, jemand könne
vorbeikommen und ihn unabsichtlich anstoßen. Jede einzelne Figur scheint er
zu prüfen. Nach gut einer Minute angestrengtem Makroblick ist die Situation
wohl geklärt. Er wandert weiter und prüft das nächste Brett auf gleiche
Weise. Komisch sieht das aus für uns Sehende. Später erzählt mir Pollinger,
dass er deswegen eigentlich selten vom Platz aufsteht, denn kaum ist man
raus aus dem Saal oder geht auch nur ein paar Schritte, sitzt schon der
nächste Blinde auf dem Platz und beugt sich elend lang zu Brett und
Mini-Picht herunter: Um zu kiebitzen.
Tastvermögen
Es gibt noch weitere Notationsmöglichkeiten. Manche Restsehende haben diese
riesigen Blätter vor sich liegen, sie benutzen große Lupen und schreiben in
riesigen Buchstaben. Bischoff benutzt so was wie ein Diktaphon, spricht
seine Notationen auf. Hans Jagdhuber hat ein Plastikbrett, das mich -
Verzeihung - an Kinder-Spielzeug erinnert. Ein gelbes Stück Plastik voller
kleiner Kästchen, in die er mit einem blauen Plastikstift selbst die Punkte
setzt.
Alle spielen auf Blindenschachbrettern. Die gibt es aber in vielen
Ausführungen. Die meisten von ihnen haben unterschiedlich hoch gelegene
Felder, um Schwarz und Weiß besser zu unterscheiden. Die schwarzen Figuren
tragen einen kleinen Nagel obenauf. "Berührt - geführt", fällt mir ein, wenn
die Finger die Figuren abtasten - und das gibt es tatsächlich! Wenn eine
Figur aus dem Steckloch genommen wurde, gilt sie als berührt und wenn sie
woanders wieder eingesteckt wurde, als dorthin geführt. Eine Korrektur ist
dann nicht mehr erlaubt, klärt mich Elisabeth Fries auf. Sie hat bei weitem
den schönsten Figurensatz. Natürlich passiere das trotzdem ab und an,
Kontrolle ist da schwer. Viel mehr passiere jedoch bei sehend-nichtsehenden
Vergleichen. Das geht dann vom fehlenden Nichtansagen der Züge über das
Gegendrücken der Uhr, obwohl der Sehende selbst am Zug ist, bis hin zum
Analysieren per Figurenrücken. Wo der Geist schwach ist, ist oft der Betrug
willig.
Aber zumindest das mit dem Uhren-Gegendrücken geschieht sicher
unabsichtlich. Man führt ja als Sehender ebenfalls den Zug des anderen aus
und obwohl inzwischen die eigene Zeit läuft, die der Blinde in Gang gesetzt
hat, drückt man reflexartig zurück. Elisabeth ist die einzige Frau unter den
Teilnehmern dieser Meisterschaft. Der Frauenanteil ist im DBSB noch
niedriger, als im Deutschen Schachbund. Gerade aktive Teilnehmerinnen gibt
es nur ganz wenige.
Was Sie schon immer über Blindenschach wissen wollten...
Frank Schellmann ist fertig mit Spielen. Er tappst durch den Raum, langsam,
sich nach allen Seiten hin vergewissernd, dass da kein Hindernis auftaucht.
Auch er sieht noch. Etwas. Ein komischer Vergleich kommt mir in den Sinn:
Sind sehbehinderte Schachspieler den Blinden gegenüber grundsätzlich im
Vorteil? Scheint mir kritisch, die Frage. Wissen will ich es trotzdem. Ich
hake nach. Ja, diese Diskussion gäbe es sicher grundsätzlich, aber sie wird
deswegen doch nicht dauernd geführt! Was sollte das auch nützen? Wie kann
man nur so dämliche Fragen stellen, ärgere ich mich über mich selbst.
Niehaus sagt: Emil Fünf. Ins Leere. Denn es sitzt niemand gegenüber. Jürgen
Pohlers, der unentwegt auf Wanderschaft ist, sitzt mal wieder gar nicht am
Brett. Natürlich sagt man den Zug dann trotzdem. Aber es hat erneut etwas
Komisches. Denn der Gegenübersitzende wiederholt ihn gewöhnlich.
Die Meisterschaften werden mit 2 Stunden für 40 Züge plus eine Stunde für
den Rest gespielt. Eine übliche Zeit für das Turnierschach also. Was aber
passiert eigentlich in Zeitnot? Beide Spieler müssen doch dann wissen, wie
viel Zeit übrig ist. Manchmal, erzählt Lang, wird dann laut gefragt: "Wie
viel Zeit habe ich noch" und ein Betreuer, falls gerade zur Stelle, darf das
dann schon mal sagen. "Aber nicht dreimal nacheinander", ergänzt Lang, "das
wird mir dann auch zuviel und ich ermahne". Und dann müssen auch die Finger
von der Uhr wegbleiben, in der Hektik könnte etwas verschoben werden oder
das Blättchen fallen.
Ich stelle mir vor, wie stressig das sein muss, wenn plötzlich Zeitnot an
mehreren Brettern ist. Frank Schellmann erzählt mir von echten
Zeitnotschlachten. Da fällt auch schon mal ne Uhr um oder das Getränk
ergießt sich über Tisch und Stuhl. Und am zweiten Turniertag erlebe ich es
selbst, ausgerechnet bei Frank. Er ist mit wenigen Minuten auf der Uhr so
nervös geworden, dass er seinen Zug ausführt und dann nicht mit links die
Uhr drückt, sondern mit rechts neben den Tisch ins Leere hämmert.
Erstaunlicherweise ist das Zeitgefühl unter den Kandidaten hier gar nicht so
ausgeprägt, wie man vermuten sollte. Es gibt oft horrende Fehler, wenn die
Konzentration nachlässt. Nun, bei uns auch, möchte man entgegnen. Zeitnot
hat hier aber seltener die psychologische Bedeutung, wie im sehenden Schach.
Es kommt auch seltener dazu.
Fair-Play
"In der Regel gibt es keinen Stress untereinander", sagt Lang. Aber bei
Duellen mit Sehenden kommt das häufiger vor. Wie sonst ist zu erklären, dass
beispielsweise Volkmar Lücke erzählt, sein mit Meisterehren ausgestattetes,
sehendes Gegenüber sagte die Züge in Zeitnot nicht mehr an? "Was wurde
gezogen?", musste er ständig fragen. Bei jedem einzelnen Zug. Prompt verlor
Lücke damals, obwohl er viel besser stand. Auch der mehrfache deutsche
Meister Dieter Bischoff weiß so eine Geschichte zu erzählen.
"Ich hatte mich gleich gewundert, dass jemand wie GM Oleg Romanischin einen
Assistenten haben wollte im Spiel gegen mich. Er, als sehender Großmeister
mit gut 300 Wertungs-Punkten mehr, verlangt gegen mich, den Blinden, eine
Assistenz. Von mir aus, dachte ich. Aber der Schiedsrichter als Assistent
reagierte in Zeitnot völlig falsch."
Während der Großmeister sehen konnte, was Bischoff auf seinem Brett bewegte,
noch bevor er die Figur zum Zielsteckpunkt führte und den Zug sagte und dann
die Uhr drückte, musste Bischoff warten, bis die Antwort kam. Und das ging
dann so: Der GM führte blitzartig seinen Zug aus und hämmerte auf die Uhr.
Während des Blinden Zeit schon längst wieder lief, informierte der Assistent
Bischoff über den Zug, dann erst konnte Dieter die Figur umstecken und
danach erst neu kalkulieren. Das kostete für jeden Zug in hoher Zeitnot so
viele Sekunden, dass er eine klare Remisstellung noch weggab. "Also wenn
schon Assistenz", beschwert sich Bischoff, "dann doch bitte jemand, der
Ahnung von den Spielregeln hat." Ein anderes Mal schlug ihm ein
Schiedsrichter beim Versuch, die Uhr zu drücken, auf die Hand. Da ist er
dann einfach aufgestanden und gegangen, denn "schlagen lassen, das wollte
ich mich beim Schachspielen nicht".
Miteinander
Die Kommunikation untereinander ist auch für mich gewöhnungsbedürftig. Die
Visualisierung spielt beim Unterhalten eine große Rolle. Zum Teil reden beim
gemeinsamen Abendessen drei bis vier Schachfreunde gleichzeitig auf mich ein
ohne zu ahnen, dass auch die anderen Aussagen mir gelten. Da das
gegenseitige Ansehen beim Ansprechen unmöglich ist, weiß man nicht, wem die
Worte gelten. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, dass alle in die
gleiche Richtung reden. Aber auch die 1:1-Situation kann kompliziert und
komisch zugleich sein. Ein typischer Dialog bei einer unvermittelten
Begegnung hört sich etwa so an: "Herbert, weißt Du wie Formel Eins
ausgegangen ist", fragt mich Hans-Peter Kuhlmann. "Herbert steht dort hinten
am Fenster, aber ich weiß es nicht"., sage ich "Bist Du fertig mit spielen?"
"Nein.", sage ich. "Ich sitze hier und tippe meine Berichte" "Ach, Sie sind
das. Entschuldigung". Später unterhalte ich mich mit einem anderen Spieler
über seine Gewinnchancen. "Chancenlos", sagt er. "da könnte ich genauso gut
gleich aufgeben und Formel 1 hören". Formel 1 hören. Das kann man
offensichtlich und es dabei spannend finden, denn es gibt einige
Motorsportfans hier.
Die eigentlich theoretisch notwendige Gleichstellung zu den Normalsehenden
ist trotzdem graue Theorie. Es gibt so viele Benachteiligungen, dass man sie
gar nicht alle aufzählen kann, erfahre ich in vielen Dialogen. Matthias
Steinhart erzählt: "Rein im schachlichen Bereich gibt es unerhört viel, was
sich zu verbessern lohnt". Dass es noch immer keine Uhr gibt, die den
Anforderungen hier gerecht wird, ist zum Beispiel so eine Sache. Gerade
jetzt mit der immer weiter um sich greifenden, neuen Bedenkzeit, bei der pro
Zug Zeit addiert wird. Wie soll der Blinde da noch wissen, wie der
Uhrenstand ist? Es müsste also Uhren geben, die sozusagen mitteilsam sind.
Bei Armbanduhren geht das ja auch. Dabei benötigt man nicht viel mehr als
eine Sprachausgabe und eine entsprechende Schnittstelle zur Uhr.
Doch die Produktionskosten sind offensichtlich astronomisch in so kleiner
Stückzahl. Einmal habe es ein Angebot eines Holländers zur Herstellung
gegeben, doch der wollte damals 20 bis 30.000 Vorschuss. Auch die ganzen
Schachzeitschriften, die müsste es doch auf CD geben, beklagt sich Matthias
Steinhart. "Wir brauchen nicht viel mehr, als die Möglichkeit, das noch mal
in ein Textformat am Rechner umzuwandeln". Lern-DVDs für Blinde?
Fehlanzeige. Wie sollte neben den Notationen der Begleittext übermittelt
werden? "Müsste machbar sein", entgegne ich. "Müsste.", antwortet Steinhart.
Bei Filmen kann man ja auch eine Begleitspur hinzutun. Und wie wird
Internetschach verfolgt? - Überhaupt nicht! Das geht nur über die
Fritz-Oberfläche, aber ohne Kommentar. Fritz oder generell die
Chessbase-Oberfläche ist die einzige Möglichkeit, Notation am Rechner in
eine Sprachausgabe umzuwandeln. Aber eben nur die Notation.
Selbstversuch
Als ich mir die Stoffserviette als Augenbinde umlege, empfinde ich das
gleiche Unwohlsein, wie zu Anfang am ersten Abend bei der Begrüßung. Die
Figuren habe ich vorsorglich noch sehend aufgestellt. Mein Getränk weit weg
von mir und mein Spielpartner Matthias Steinhart verspricht mir, die Zeit
anzusagen, denn er wird sie von der Uhr ertasten. 30 Minuten Bedenkzeit für
jeden. Während ich mich völlig hilflos ausschließlich auf die Figuren vor
mir und das Spiel konzentriere, tastet Matthias während des Spiels die Uhr,
unterhält sich mit dem Nachbarn, gibt mir den Zeitverhältnisse durch und
genießt seinen Drink.
Zu Anfang spüre ich noch die kleinen Nägel auf den Köpfen der schwarzen
Figuren, das Zentrum ist leer, ich kann die erhobenen schwarzen Felder
deutlich von den weißen unterscheiden. Die Eröffnung verläuft dank einem
angenehmen Verlauf problemlos. Ungewohnt ist, die Figuren des anderen mit
von Platz zu Platz zu stecken. Außerdem muss ich mit dem linken Zeigefinger
das Steckloch des Feldes ertasten, damit ich die Figur da einigermaßen
sicher mit rechts versenke. Ich habe während des Turniers Spieler gesehen,
die das einhändig zielsicher auf Anhieb schaffen. Bis ins Mittelspiel geht's
noch locker. Doch stellen sich zwei interessante Phänomene ein.
Zum einen folge ich den Gesprächen am eigenen Tisch und an denen rundum,
anstatt die Konzentration weiter auf dem Brett zu halten. Mit jedem Zug
fällt mir das Spielen schwerer. Zum anderen fange ich an, das Ertasten zu
ignorieren und mehr meiner Vorstellung zu folgen, also ohne Hilfsmittel
blind zu spielen. Ich achte längst nicht mehr auf Figuren mit oder ohne
Nägel, ich merke mir einfach alle Figuren und wie die Felder besetzt sind.
Aber ich weiß aus Erfahrung, dass mich meine untrainierte Vorstellungsgabe
irgendwann verlässt und so zwinge ich mich, an den Figuren festzuhalten.
"Bestimmt ist mehr für mich drin", denke ich, doch jeder weitere Zug lässt
trotz Figurentausch meine Aufmerksamkeit schwinden. Dass das für Anfänger
normal sei, erzählt man mir erst hinterher. Fast alle haben hier
Endspielschwächen. Womöglich, weil die Räume zwischen den Figuren immer
größer werden. Und für einen Ungeübten wie mich, sei das schon mal sehr gut.
Trotzdem. Meine Kräfte schwinden. Es wird mit zunehmender Zeit immer
anstrengender und ich kann schon bald keinen auch nur halbwegs klaren
Gedanken zu fassen und dann: Schachlicher Blindflug. Planlos. Ich bin
erleichtert, als Matthias mir Remis anbietet, dieses bis dato noch etwa
gleiche Endspiel hätte ich glatt vergeigt. Ich bin fix und fertig.
Als ich die Augenbinde abnehme, brauche ich gute zwei Minuten, mich wieder
an das Saallicht zu gewöhnen. Später, als wir analysieren, sitzt Andreas
Ilic neben mir. Wie sich herausstellt, hat Andreas das Spiel hörend
verfolgt, ohne (woher auch?) vom Selbstversuch zu wissen. Jetzt aber, wo ich
wieder sehe und Matthias weiter tastend analysiert, stellt sich erst die
ganze Routine des kiebitzenden Blindspielers heraus. Andreas legt eine
komplette Analyse des Spiels hin und überrascht mich mit unzähligen
Varianten, von denen die meisten weitaus interessanter sind, als das, was
ich gerade zum Ende hin so vor mich hingepatzt hatte.
Blind sehen
Anton Lindenmair ist einer, der ziemlich viel fürs Blindenschach tut. Er
informiert seine Kollegen regelmäßig über Nachrichten aus der Schachwelt,
speziell natürlich aus dem Blindenschach. Faktisch mein Pendant. Auch die
Webseite des DBSB ist nun unter seiner Regie. Dazu braucht er aber kein
Sehvermögen. Mit Programmiersprachen beschäftigt er sich schon ziemlich
lange. Er erstellt die Seiten direkt in Programmcode, schreibt sich die
kleinen Helferlein, die den Text formatieren und in html umwandeln, selbst.
Mit Herbert Lang hat er einen Assistenten, der auch Nachrichten verteilt.
Über Google News holt sich Lindenmair viele Anregungen und sucht nach
Schachnachrichten, auch den Mediaservice des DSB hat er schon genutzt. Aber
woher weiß er, was da steht? Auch das ahnt man: Dumme Frage. Denn es gibt
einen Screenreader, der die kompletten Seiten samt Inhalten und Dialogboxen
auswertet und dann vorliest.
"Ist die Sprachausgabe denn verständlich?" "Früher war es mal ,ne Folter",
wirft Vorsitzender Ludwig Beutelhoff ein, "aber inzwischen gewöhnt man sich
dran". Einen Bildschirmausschnitt kann man übrigens auch in
Sechs-Punkte-Blindenschrift transformieren, das geht mit einer Art Pad, auf
dem sich Stäbchen nach oben schieben, und dann kann man das abtasten. Eine
Software, die mit dem Pad mitgeliefert wird, sorgt nach der Installation für
die abtastbare Ausgabe. Die Sprachausgabe erzählt, wohin bestimmte Elemente,
wie pgn-Dateien, geladen oder gespeichert werden. Und genau wie wir Sehende
markiert man den Bildschirminhalt und speichert über die Zwischenablage in
eine Datei. Nichts leichter als das, lacht Toni.
Es gibt übrigens noch mehr Mitteilungsmöglichkeiten, als die regelmäßigen
E-mails und die Internetseiten der Lindenmairs und Langs. Eckhard Kröger ist
Redakteur des Punktschrifthefts, dass in regelmäßigen Intervallen erscheint.
Hier wird quasi mühsam in Brailleschrift getippt und verteilt. Dann ist da
noch der Schachexpress. Ein Hörmagazin, dass etwa monatlich erscheint und
über Schachereignisse informiert und in dem die Nachrichten verlesen werden.
Diese Reportage hier erscheint übrigens auch dort - ich werde sie selbst
sprechen.
Bis neulich
Dienstag, am dritten Turniertag, muss ich leider aufbrechen. Ich habe hier
mehr über Blinde und das Schach miteinander gelernt, als je zuvor. Ich habe
hochinteressante, intelligente und sympathische Menschen kennen gelernt, von
denen man eine Menge lernen kann. Die mit ihrem Handicap auf sehr natürliche
und ungezwungene Weise umgehen und die meisten von ihnen sind durchweg
fröhliche Zeitgenossen. Ich betone das, weil ich im gewöhnlichen Schachleben
immer und immer wieder auf einen sehr großen Anteil an Mitgliedern treffe,
die nie mehr lernen werden, dass wir nur miteinander spielen. Die weder
verlieren, noch gewinnen können. Die nur schwarz-weiß denken und ebenso
sehen.
"Dann möchte ich mich mal verabschieden, Herr Lais", sagt mir Peter
Staubach, der die Meisterschaft leider nicht mitspielen kann. Wir tauschen
ein paar nette Dinge aus und plaudern über die Meisterschaften, das Wetter,
den DSB. "Na denn" sagt er, "ich muss nun los".
"Ja", sage ich.
"Wir sehen uns".
zurück zur Startseite
© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.